
Gehypt – gefloppt: 12 digitale Fails seit den Anfängen
Seit den frühesten Tagen der Digitalisierung Ende der 1970er, Anfang der 1980er, kamen unzählige neue Erfindungen und Ideen heraus. Einige davon erlebten nach dem anfänglichen Hype einen Absturz und stellten sich als Flop heraus. Wir werfen einen Blick auf die Fails und erläutern euch, weshalb sie gescheitert sind.
Top oder Flop – der Markt entscheidet
Manche digitalen Innovationen wurden zu weltweiten Erfolgen – etwa das Smartphone. Manche wiederum müssen sich auf dem Markt noch behaupten: E-Wallets gibt es beispielsweise schon recht lange. Es dauerte allerdings eine ganze Zeit, bis die digitale Bezahlmöglichkeit von einer größeren Zahl an Usern angenommen wurde. Wieder andere digitalen Tools verschlangen zunächst Unsummen an Investorengeldern und konnten die hohen Erwartungen am Ende doch nicht erfüllen.Ganz unterschiedliche Gründe sind verantwortlich dafür, ob sich eine Idee durchsetzen kann oder wieder in der Versenkung verschwindet. Unsere Beispiele zeigen einen Einblick in verschiedene kreative Lösungen, die (bisher) keinen Erfolg hatten.
Apple Lisa & Newton
Der „Apple Lisa“, der 1983 auf den Markt kam, war Apples Versuch, den ersten kommerziellen Computer mit einer grafischen Benutzeroberfläche und einer Maus zu entwickeln. Während die meisten Computer damals nur über Befehlszeilen bedient wurden, war das Lisa-System seiner Zeit weit voraus. Der „Newton“ war ein persönlicher digitaler Assistent (PDA), der 1993 eingeführt wurde. Die Vision dahinter war beeindruckend: Ein Gerät, das Texte handschriftlich erkennt, Notizen speichert und Termine verwaltet. „Newton“ war quasi der Urvater des heutigen Smartphones.
Doch warum scheiterten beide? Der Apple Lisa war mit einem Preis von fast 10.000 US-Dollar für die meisten Menschen unbezahlbar. Hinzu kamen technische Probleme: Der Computer war langsam, instabil und bot eine geringe Kompatibilität mit anderen Systemen. Auch die Software war noch nicht ausgereift, und viele Nutzer empfanden die Bedienung als zu komplex. Obwohl der Lisa technologisch fortschrittlich war, konnte er sich gegen den günstigeren IBM-PC nicht durchsetzen. Doch Apple hat aus seinen Fehlschlägen gelernt und mit „Lisa“ die Grundlagen für den späteren Erfolg des Macintosh gelegt.
Beim Newton war es vor allem die Handschrifterkennung, die ihn zum Gespött der Nutzer machte. Die Technologie war schlicht nicht ausgereift und statt Worte richtig zu erkennen, produzierte das Gerät oft völlig unverständliche Zeichenfolgen. Auch hier war der Preis zu hoch, um eine breite Käuferschicht anzusprechen. Erst Jahre später, mit der Einführung des iPhones, konnte Apple die Idee eines digitalen Assistenten in perfekter Form umsetzen.
Juicero
Juicero wurde 2016 mit großem Hype als High-Tech-Lösung für frischen, kaltgepressten Saft vorgestellt. Die Idee hinter dem Produkt war auf den ersten Blick vielversprechend: Ein kompaktes, modernes Gerät, das durch die Verbindung mit dem Internet dafür sorgte, dass Nutzer zu Hause auf Knopfdruck frischen, kaltgepressten Saft genießen konnten – sauber, einfach und ohne Chaos. Die Nutzer mussten lediglich einen speziellen, vorab gefüllten Saftbeutel in das Gerät legen, der dann von der Juicero-Maschine ausgepresst wurde. Der eigentliche Clou: Die Beutel waren mit einem QR-Code ausgestattet, den das Gerät vor dem Pressen einscannte, um zu prüfen, ob der Inhalt noch frisch war. Alles sollte perfekt durchdacht sein – und das für den stolzen Preis von rund 400 US-Dollar.
Juicero hatte jedoch von Beginn an mit erheblichen Problemen zu kämpfen, die letztendlich zum Scheitern führten. Der größte und verhängnisvollste Fehler war das Missverhältnis zwischen der angebotenen Technologie und dem tatsächlichen Nutzen. Wie sich herausstellte, konnte man die Saftbeutel auch einfach mit der Hand ausdrücken, und zwar genauso effektiv wie mit dem teuren Gerät. Dies wurde in einem inzwischen berüchtigten Test von „Bloomberg“ 2017 bewiesen.
Ein weiteres Problem war das Geschäftsmodell. Juicero setzte nicht nur auf den Verkauf des Geräts, sondern auch auf den Verkauf der teuren, firmeneigenen Saftbeutel. Diese Saftbeutel waren nur über Juicero erhältlich und erhöhten die laufenden Kosten für die Nutzer erheblich. Sobald klar wurde, dass der Beutel auch ohne die teure Maschine funktionierte, hinterfragten immer mehr Verbraucher, warum sie für ein solches Gerät Geld ausgeben sollten.
NFTs (Non-Fungible Tokens)
NFTs (Non-Fungible Tokens) erlebten 2021 einen rasanten Aufstieg als eines der heißesten Themen in der digitalen Kunstwelt. Im Kern sind NFTs einzigartige, digitale Zertifikate, die auf der Blockchain-Technologie basieren. Sie dienen als Eigentumsnachweise für digitale Güter, wie Kunstwerke, Musik, Videos oder sogar virtuelle Grundstücke. Im Gegensatz zu Kryptowährungen wie Bitcoin, die untereinander austauschbar sind, ist jedes NFT einzigartig (non-fungible), was es für Sammler besonders macht. Ein NFT ermöglicht es theoretisch, ein digitales Werk zu besitzen, obwohl das Werk selbst weiter im Internet verbreitet und kopiert werden kann.
NFTs wurden als die Zukunft des Eigentums an digitalen Kunstwerken und Sammlerstücken beworben. Sie schufen eine Möglichkeit, die Wertschöpfung digitaler Kunst zu revolutionieren, indem sie Künstlern direkte Einnahmen ermöglichten und gleichzeitig Sammlern das exklusive Besitzrecht an einem Werk verschafften. Einige NFTs wurden für Millionen von Dollar verkauft – das digitale Kunstwerk „Everydays: The First 5000 Days“ des Künstlers Beeple brachte bei einer Auktion über 69 Millionen US-Dollar ein und schürte die Spekulation, dass NFTs die Zukunft der Kunstwelt sein könnten.
Obwohl die Idee hinter NFTs viel Potenzial birgt, hat sich der Hype als Spekulationsblase entpuppt, die schnell geplatzt ist. Das Hauptproblem lag in der extremen Volatilität des Marktes. Während einige NFTs für Millionen verkauft wurden, verloren viele von ihnen innerhalb weniger Monate dramatisch an Wert. Schließlich stellte sich noch heraus, dass der NFT-Markt auch durch Betrug und Plagiate geprägt war. Viele Künstler berichteten, dass ihre Werke ohne Erlaubnis als NFTs verkauft wurden, was zu erheblichen Kontroversen führte.
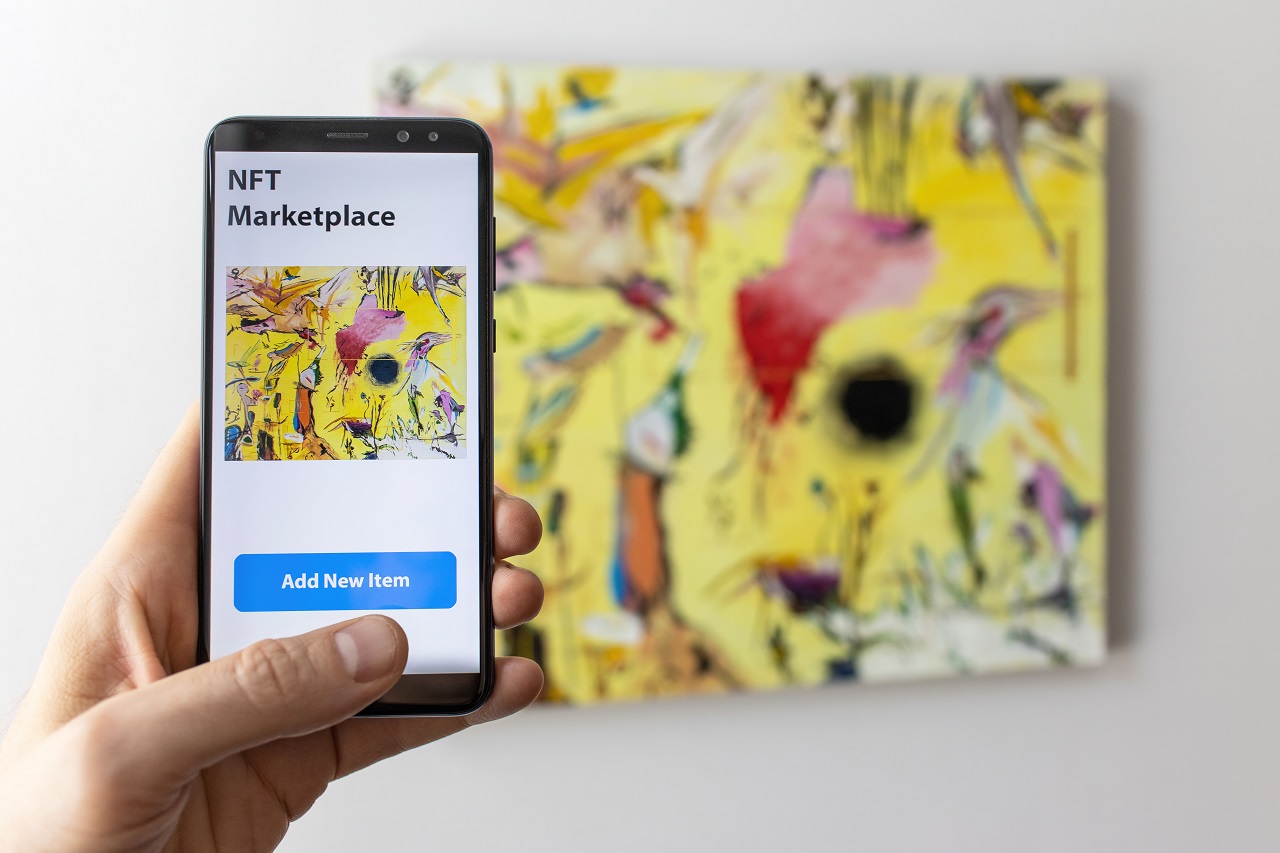
MySpace
MySpace war die erste große Social-Media-Plattform und wurde 2003 gegründet. Sie ermöglichte es Nutzern, ihre eigenen Profile zu gestalten, Freunde hinzuzufügen, Musik zu teilen und miteinander zu interagieren. Besonders für Bands und Musikliebhaber bot MySpace eine ideale Plattform, um ihre Musik direkt zu veröffentlichen und mit Fans zu interagieren. Die Plattform war extrem populär und erreichte Mitte der 2000er Jahre weltweit über 100 Millionen Nutzer.
Als 2004 Facebook auf den Markt kam, war das Ende von MySpace aus mehreren Gründen besiegelt. Während es den Nutzern ermöglichte, ihre Profile individuell zu gestalten, führte diese Freiheit oft zu überladenen und schlecht designten Seiten, die langsam luden und den Nutzern ein unübersichtliches Erlebnis boten. Im Gegensatz dazu war Facebook klar strukturiert und einfacher zu bedienen, was viele Nutzer ansprach.
MySpace wurde 2005 von Rupert Murdochs News Corporation übernommen. Die neuen Eigentümer waren jedoch mehr daran interessiert, kurzfristige Gewinne durch Werbung zu erzielen, als die Plattform technologisch weiterzuentwickeln und an den sich verändernden Markt anzupassen. Im Gegensatz dazu investierte Facebook kontinuierlich in die Verbesserung der Benutzererfahrung. Bis 2011 verlor MySpace fast seine gesamte Nutzerbasis und wurde schließlich verkauft.
AltaVista
AltaVista war eine der ersten leistungsstarken Suchmaschinen im Internet, die 1995 entwickelt wurde. In den frühen Tagen des Internets bot AltaVista revolutionäre Funktionen, die viele Konkurrenten nicht hatten. Es war die erste Suchmaschine, die eine umfassende Volltextsuche ermöglichte. Nutzer konnten so ganze Webseiten nach beliebigen Wörtern durchsuchen.
AltaVista dominierte die Suchmaschinenszene Mitte bis Ende der 1990er Jahre, doch der Aufstieg von Google im Jahr 1998 änderte alles. Google führte eine völlig neue Art der Suche ein, die nicht nur auf Volltextindexierung basierte, sondern auf einem komplexen Algorithmus namens PageRank. Dieser bewertete Webseiten nicht nur nach ihren Inhalten, sondern auch nach ihrer Relevanz und den Verlinkungen von anderen Seiten.
Nachdem AltaVista von Compaq übernommen wurde, führte dies zu weiteren Fehlentscheidungen, wie der Integration in das Yahoo-Netzwerk im Jahr 2003. Yahoo hatte zu diesem Zeitpunkt ebenfalls den Fokus auf seine eigene Suchmaschine gelegt, sodass AltaVista langsam in den Hintergrund gedrängt wurde. Schließlich wurde die Suchmaschine 2013 endgültig eingestellt.
MiniDisc
Die MiniDisc wurde 1992 von Sony als eine Weiterentwicklung von analogen und digitalen Medien wie der Kassette und CD auf den Markt gebracht. Sie bot eine kompakte, robuste Alternative zur CD und konnte neben Musik auch Daten speichern, was damals ein großer Vorteil war. Die Discs waren klein, tragbar und wiederbeschreibbar, was sie besonders für Musikliebhaber und DJs interessant machte. Sony entwickelte außerdem tragbare MiniDisc-Player und -Recorder, die sich an musikaffine Zielgruppen richteten. Die Geräte waren leicht, langlebig und ermöglichte es Nutzern, ihre eigenen Musikaufnahmen zu machen.
Die größte Bedrohung für die MiniDisc kam mit dem Aufkommen der digitalen Musikformate, insbesondere MP3. Ab Ende der 1990er Jahre begannen tragbare MP3-Player den Markt zu erobern. Hunderte von Songs konnten auf einem einzigen Gerät gespeichert werden, ohne physische Discs mitschleppen zu müssen. Mit der Einführung des iPods im Jahr 2001 wurde die MiniDisc dann endgültig obsolet. Sony stellte schließlich die Produktion von MiniDisc-Playern 2013 ein und beendete damit das Kapitel dieser Technologie.

Capacitance Electronic Disc (CED)
Die Capacitance Electronic Disc (CED) war ein analoges Videodisksystem, das von RCA entwickelt wurde und 1981 auf den Markt kam. Die CED sah aus wie eine Schallplatte und nutzte eine ähnliche Technologie: Filme wurden in Rillen auf der Scheibe gespeichert und mittels eines Nadel-Systems auf speziellen CED-Playern abgespielt. Die CED war als eine Alternative zu VHS-Kassetten und Betamax-Videobändern gedacht, die zu dieser Zeit den Heimvideomarkt dominierten. Die Discs hatten eine längere Lebensdauer als VHS-Kassetten, und da sie nicht zurückgespult werden mussten, war das Abspielen von Filmen bequemer.
Trotz der ambitionierten Vision erwies sich die CED als gewaltiger Flop. Als sie 1981 endlich auf den Markt kam, war sie bereits veraltet. VHS und Betamax hatten den Heimvideomarkt bereits fest in ihrer Hand. Diese Systeme boten den großen Vorteil, dass man nicht nur Filme abspielen, sondern auch Sendungen aufnehmen konnte. RCA stellte die Produktion von CEDs und Abspielgeräten 1984 nach nur drei Jahren ein, nachdem das Unternehmen massive Verluste eingefahren hatte. Der Flop der CED war so gravierend, dass er letztlich maßgeblich dazu beitrug, dass RCA als eigenständiges Unternehmen aufgelöst wurde.
Atari CX77 Wireless Joystick
Der Atari CX77 war ein kabelloser Joystick, der für die Atari 2600 entwickelt wurde. Das Konzept hinter dem CX77 war geradezu revolutionär: Ein Controller, der es Spielern ermöglichte, ohne störende Kabelverbindungen von überall im Raum aus zu spielen. Die Technologie basierte auf Infrarotverbindungen, ähnlich wie die Fernbedienungen für Fernseher, und sollte ein freies, flexibles Spielerlebnis bieten.
Obwohl der CX77 seiner Zeit in vielerlei Hinsicht voraus war, scheiterte er an mehreren technischen und praktischen Problemen. Eines der größten Hindernisse war die unreife Funktechnologie, die eine direkte Sichtlinie zwischen dem Controller und dem Empfänger voraussetzte. Schon eine kleine Unterbrechung, wie eine Person, die zwischen Controller und Konsole hindurchging, konnte die Verbindung unterbrechen. Das führte zu verzögerten oder gar verlorenen Eingaben, was gerade bei schnellen Spielen extrem frustrierend war.
Es dauerte schließlich bis zu den späten 1990er Jahren, als Technologien wie Infrarot und später Bluetooth ausgereift genug waren, um kabellose Controller wirklich praktisch zu machen. Der CX77 bleibt ein Beispiel dafür, wie eine visionäre Idee an den technologischen Gegebenheiten der Zeit scheitern kann.
Segway
Der Segway Personal Transporter wurde 2001 mit großem Hype und riesigen Erwartungen eingeführt. Der Entwickler, Dean Kamen, stellte sich vor, dass der Segway den städtischen Verkehr revolutionieren würde. Das selbstbalancierende Fahrzeug wird durch die Neigung des Körpers gesteuert. Die Technologie dahinter war bahnbrechend: Gyroskopische Sensoren und fortschrittliche Elektronik hielten das Fahrzeug in Balance, und der Fahrer muss lediglich sein Gewicht verlagern, um vorwärts, rückwärts oder seitwärts zu fahren.
Trotz der anfänglichen Begeisterung war der Segway von Anfang an mit Hindernissen konfrontiert. Zunächst einmal war das Gerät mit um die 5.000 US-Dollar recht teuer. Ein weiteres Problem war die fehlende praktische Nutzbarkeit. Der Segway war für viele Umgebungen schlichtweg nicht geeignet: Er war zu groß für enge Gehwege, zu langsam für den Straßenverkehr und wurde oft von den Verkehrsbehörden in Städten reguliert oder sogar verboten.
Ein weiteres Problem war das Image. Der Segway wurde oft als Spielzeug für reiche Menschen wahrgenommen, die ihn nicht für den täglichen Bedarf, sondern für kurze Freizeitfahrten nutzten. Es gab auch Sicherheitsbedenken: Viele Nutzer hatten Schwierigkeiten, das Gerät zu steuern, was zu Unfällen führte. Einige dieser Unfälle, darunter prominente Vorfälle, wie der tragische Tod von Jimi Heselden, dem Besitzer von Segway Inc., trugen zum negativen Image bei. Heselden stürzte 2010 mit einem Segway von einer Klippe und starb, was den Ruf des Geräts weiter beschädigte. Heute sind geführte Segwaytouren durch Städte und entlang von Sehenswürdigkeiten etabliert.

Google+
Google+ wurde 2011 als ambitioniertes Projekt von Google ins Leben gerufen und sollte eine direkte Konkurrenz zu Facebook darstellen. Die Plattform wurde als soziales Netzwerk konzipiert, das Teil des Google-Ökosystems war. Nutzer konnten auf Google+ Inhalte posten, Fotos teilen und über verschiedene Google-Dienste hinweg miteinander kommunizieren. Eine der Hauptinnovationen von Google+ war das „Kreise“-System, mit dem Nutzer ihre Kontakte in verschiedene Gruppen einteilen konnten, um Inhalte gezielt nur mit bestimmten Personengruppen zu teilen.
Viele Nutzer empfanden die Bedienung der Plattform jedoch als zu kompliziert. Das „Kreise“-System war in der Praxis oft umständlich und verwirrend. Die Nutzer mussten ihre Kontakte manuell in Kreise einordnen, was die Plattform komplizierter machte als das einfachere Freundschaftssystem von Facebook. Ein weiteres großes Problem war die erzwungene Integration von Google+ in andere Google-Dienste, insbesondere YouTube, was allerdings zu einem großen Aufschrei führte. YouTube-Nutzer waren frustriert, dass sie Google+ benötigten, um Kommentare abzugeben oder Profile zu verwalten, was den Unmut über die Plattform weiter verstärkte. Die Einstellung des Dienstes im Jahr 2018 markierte das Ende eines der größten gescheiterten Projekte in der Geschichte von Google.
VR-Filme
Mit VR-Filmen sollten die Zuschauer vollständig in die Handlung eintauchen können. Anders als bei herkömmlichen Filmen, wo der Zuschauer eine feste Kameraperspektive hat, erlaubt die Technologie hinter der Virtuellen Realität, sich in der virtuellen Umgebung umzusehen und die Handlung aus verschiedenen Blickwinkeln zu verfolgen. Mit der Einführung von VR-Headsets wie Oculus Rift, HTC Vive und PlayStation VR in den 2010er Jahren stieg die Hoffnung, dass VR nicht nur die Gaming-Welt, sondern auch das Kino revolutionieren würde.
Obwohl die Idee faszinierend ist, blieb ein zentrales Problem die technische Reife. Die Bildqualität der VR-Headsets konnte mit der von traditionellen Kinos nicht mithalten. Hinzu kam die sogenannte "Motion Sickness": Viele Nutzer fühlten sich beim Anschauen von VR-Filmen unwohl, da die virtuelle Bewegung nicht mit den Bewegungen des eigenen Körpers übereinstimmte. Dies führte zu Übelkeit, Schwindel und Kopfschmerzen, was das Ansehen von VR-Filmen für viele unangenehm machte.
Das Filmen und Entwickeln in 360-Grad-Perspektiven erforderte teure Technologie und spezielle Kameras, was die Herstellungskosten in die Höhe trieb. Außerdem waren viele Regisseure und Produzenten unsicher, wie sie Geschichten in diesem neuen Medium am besten erzählen konnten. Traditionelle filmische Mittel wie Schnitte, Zooms oder Kamerafahrten funktionieren in VR nicht auf die gleiche Weise, und das neue Format erforderte ein völlig anderes Geschichtenerzählen. Während VR im Gaming-Bereich weiterhin relevant ist, bleibt der Durchbruch in der Filmbranche aus.

Seiko UC-2000
Die Seiko UC-2000 war eine der ersten Smartwatches der Welt und kam 1984 auf den Markt. Die UC-2000 war eine bahnbrechende Innovation in Form einer kleinen „Computeruhr“, die mit einem Minidisplay ausgestattet war. Die Uhr konnte einfache Aufgaben wie das Speichern von Texten und Notizen ausführen und war über eine Dockingstation mit einem PC verbindbar.
Das kleine Display und die umständliche Eingabemethode machten die Uhr jedoch schwer bedienbar. Texte einzugeben oder Notizen zu erstellen war mühsam und die Displaygröße begrenzte den praktischen Nutzen der Uhr stark. Für viele Nutzer war die Interaktion mit der UC-2000 eher eine technische Spielerei als ein echter Produktivitätsgewinn.
Mitte der 1980er Jahre hatten die meisten Menschen noch kein Bedürfnis nach einem tragbaren Computer am Handgelenk. Die Idee war ihrer Zeit weit voraus, da die meisten Nutzer noch nicht einmal PCs in ihrem täglichen Leben verwendeten. Die Notwendigkeit für ein tragbares digitales Notizgerät war einfach nicht gegeben. Die Smartwatch-Idee musste noch viele Jahre warten, bis sie mit der Einführung der Apple Watch 2015 und ähnlichen Geräten in den Mainstream gelangte. Die UC-2000 war ein typisches Beispiel für eine brillante Idee, die jedoch viel zu früh auf den Markt gebracht wurde, um Erfolg zu haben.
Bildquellen:
Bild 1: Adobe Stock © golubovy
Bild 2: Adobe Stock © Ilya
Bild 3: Adobe Stock © Maarten
Bild 4: Adobe Stock © studio4pic
Bild 5: Adobe Stock © Drobot Dean
